Auswirkungen von Stress auf den Organismus
- Thomas Laggner
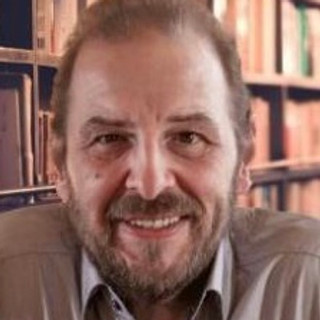
- 28. Sept. 2025
- 2 Min. Lesezeit
1. Physiologische Auswirkungen von Stress
Stress aktiviert das vegetative Nervensystem (v. a. den Sympathikus) und die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (HPA-Achse).
Ausschüttung von Stresshormonen (Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol).
Erhöhung von Herzfrequenz, Blutdruck und Atemfrequenz – Anpassung an Kampf- oder Fluchtreaktionen.
Unterdrückung „nachrangiger“ Systeme wie Verdauung, Immunsystem und Fortpflanzung.
Langfristig: Erhöhtes Risiko für Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Magen-Darm-Störungen, Diabetes Typ 2 und bestimmte Autoimmunerkrankungen.
2. Psychische Auswirkungen
Stress wirkt nicht nur auf den Körper, sondern greift tief in die Funktionsweise des Gehirns ein. Dabei spielen insbesondere drei Strukturen eine zentrale Rolle: der Hippocampus, die Amygdala und der präfrontale Cortex. Unter dem Einfluss von Stresshormonen kann der Hippocampus – wichtig für Gedächtnis und Lernprozesse – in seiner Plastizität eingeschränkt werden. Gleichzeitig führt eine Überaktivierung der Amygdala zu einer verstärkten Angst- und Bedrohungswahrnehmung, wodurch die emotionale Belastung steigt. Parallel dazu wird die Aktivität des präfrontalen Cortex geschwächt, was die Fähigkeit zu rationalem Denken, vorausschauender Planung und Emotionsregulation mindert.
Diese Veränderungen erklären, warum chronischer Stress langfristig zu einer erhöhten Anfälligkeit für Depressionen, Angststörungen, Burnout und psychosomatische Beschwerden führt. Das Gehirn gerät gewissermaßen in ein Ungleichgewicht: Alarm- und Gefahrenzentren sind übererregt, während die Steuerungs- und Regulationsinstanzen geschwächt werden. Psychische Stressfolgen sind daher nicht nur subjektiv erlebte Belastungen, sondern messbare neurobiologische Prozesse, die den Alltag, das Erleben und die Lebensqualität stark beeinträchtigen können.
Chronischer Stress beeinflusst die Gehirnfunktion direkt:
Hippocampus: Stresshormone können Gedächtnisprozesse beeinträchtigen und die neuronale Plastizität verringern.
Amygdala: Überaktivierung führt zu erhöhter Angst- und Bedrohungswahrnehmung.
Präfrontaler Cortex: Stress schwächt die Fähigkeit zu rationalem Denken, Planung und Emotionsregulation.
Folgen: Erhöhtes Risiko für Depressionen, Angststörungen, Burnout und psychosomatische Beschwerden.

3. Stressassoziierte Frühwarnzeichen
Vor dem Auftreten manifester Erkrankungen zeigt der Organismus Warnsignale wie:
Schlafstörungen
Kopfschmerzen, Hörgeräusche
Verdauungsprobleme, Appetitveränderungen
Gewichtszunahme oder -abnahme
Blutdruckerhöhungen
Diese Symptome sind Ausdruck eines Ungleichgewichts zwischen Stressoren und Ressourcen.
4. Stress, Vulnerabilität und Resilienz
Nach dem Vulnerabilitäts-Stress-Modell führt nicht Stress allein, sondern die Interaktion zwischen individueller Verletzlichkeit (biologisch, genetisch, biografisch) und aktuellen Belastungen zur Erkrankung.
Menschen mit höherer Vulnerabilität erkranken schneller, wenn Stressoren überwiegen.
Ressourcen wie soziale Unterstützung, Selbstfürsorge, Selbstwirksamkeit und Sinnerleben wirken als Gegengewichte und erhöhen Resilienz.
5. Salutogenetische Perspektive
Stress ist nicht nur schädlich, sondern kann – richtig integriert – auch entwicklungsfördernd sein („heilsame Stressoren“).
Nach Antonovskys Konzept der Salutogenese hängt Gesundheit nicht allein von Risikominimierung ab, sondern von der Fähigkeit, Kohärenz (Verstehbarkeit, Handhabbarkeit, Sinnhaftigkeit) herzustellen.
Selbstverwirklichung im Sinne von Selbstbestimmung, Selbstwerdung und Selbstrealisierung trägt wesentlich dazu bei, Stress in Wachstum und innere Stärke umzuwandeln.
6. Langfristige Folgen chronischen Stresses
Körperlich: Herzinfarkt, Schlaganfall, Immunschwäche, Stoffwechselstörungen.
Psychisch: Depression, Burnout, Angststörungen, Sucht.
Sozial: Rückzug, Konflikte, verringerte Leistungsfähigkeit.
Existentiell: Gefühl der Entfremdung vom „wahren Selbst“, Sinnverlust, Identitätskrisen.
7. Fazit
Stress ist ein doppelgesichtiges Phänomen: kurzfristig überlebenswichtig, langfristig krankmachend – außer er wird durch ausreichende Ressourcen und ein starkes Kohärenzgefühl abgepuffert.
Schlüssel zur Stressbewältigung ist nicht die vollständige Vermeidung von Stress, sondern die Stärkung von Resilienzfaktoren, Selbstverwirklichung und Sinnorientierung.
Gesundheit entsteht dynamisch im Austarieren von Stressoren und Ressourcen, eingebettet in biologische, psychologische und soziale Kontexte.


