Pursuer–Withdrawer-Dynamik in der personzentrierten Theorie
- Thomas Laggner
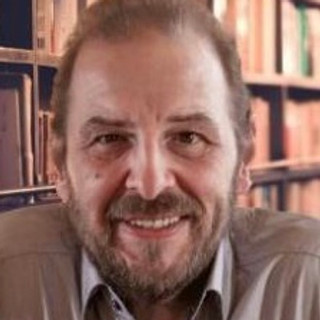
- 22. Nov. 2025
- 5 Min. Lesezeit
In vielen Paarbeziehungen begegnen wir einem wiederkehrenden Muster, das sich nicht aus der Absicht eines der Partner ergibt, sondern aus der Weise, wie beide in Momenten emotionaler Unsicherheit versuchen, sich selbst zu schützen und gleichzeitig in Verbindung zu bleiben. Dieses Muster lässt sich als Pursuer–Withdrawer-Dynamik beschreiben: ein Bewegungsduett aus Vorwärts- und Rückzugstendenzen, das – wenn wir es genau betrachten – nicht Ausdruck mangelnder Liebe oder fehlender Reife ist, sondern Ausdruck einer zutiefst menschlichen Suche nach Sicherheit, Angenommensein und innerer Ordnung.
Wenn Menschen einander nahe sind und die Beziehung für sie von Bedeutung ist, dann werden diese Bewegungen mit besonderer Intensität spürbar. Der eine Partner mag das Gefühl haben, die Distanz des anderen bedrohe ihn in seinem Selbstgefühl, weshalb er sich bemüht, den Kontakt wiederherzustellen, oft mit Worten, manchmal auch mit dem Drang, die innere Verwirrung zu klären und das Unverstandene zu benennen. Der andere hingegen erlebt dieselbe Situation möglicherweise als emotional überwältigend, als zu schnell, zu laut oder zu drängend, so dass sein Organismus ihm signalisiert, sich zurückzuziehen, um wieder einen inneren Raum zu finden, in dem er sich selbst noch hören kann.
In der personzentrierten Theorie sprechen wir hier von zwei inneren Bezugsrahmen, die unter Stress enger und fragiler werden, so dass beide Partner immer weniger Zugang zueinander finden, während sie gleichzeitig beide versuchen, die Integrität ihres Selbst zu bewahren.

1. Der Pursuer – jene Bewegung, die aus Angst nach vorne drängt
Derjenige, den wir in diesem Muster „Pursuer“ nennen, handelt nicht aus einem Wunsch heraus, zu dominieren oder zu kontrollieren, sondern vielmehr aus einer tiefen, oft schmerzlichen Wahrnehmung von Distanz, die sich für ihn wie ein Verlust des emotionalen Bodens anfühlt. Wenn er bemerkt, dass der andere sich zurückzieht, beginnt in ihm eine Aktivierung, die kaum noch aufzuhalten scheint. Es ist die Art Aktivierung, die entsteht, wenn das Gefühl auftaucht, verlassen oder nicht gesehen zu werden.
In einer solchen Aktivierung wird das eigene Erleben drängender und dringlicher, als wäre es notwendig, alles zu sagen, was im Inneren vor sich geht, bevor die Verbindung endgültig abreißt. Der Mensch spricht nicht, weil er zu viel will, sondern weil er fürchtet, zu wenig zu sein. Er erklärt nicht, weil er besser weiß, sondern weil er verzweifelt versucht, den Kontakt zu retten. Und er kritisiert nicht, weil er den anderen herabsetzen möchte, sondern weil das Gefühl der Einsamkeit ihn drängt, die Defizite sichtbar zu machen, die er für den Verlust der Verbindung verantwortlich macht.
In Rogers’ Begrifflichkeit ließe sich sagen, dass der Pursuer eine Inkongruenz erlebt zwischen dem tiefen organismischen Bedürfnis nach Nähe und dem oft verinnerlichten Selbstbild, aushalten und ruhig bleiben zu müssen. Diese Spannung erzeugt das Drängen nach außen: ein Versuch, die eigene Verletzlichkeit nicht fühlen zu müssen.
2. Der Withdrawer – jene Bewegung, die aus Überforderung nach innen weicht
Der Withdrawer hingegen bewegt sich nicht weg, weil ihm die Beziehung unwichtig wäre oder weil er nicht fühlen könnte, sondern weil die Intensität des Moments sein Nervensystem überflutet. Für ihn kann die Emotionalität des anderen wie eine Welle erscheinen, die keine Luft mehr lässt. In solchen Momenten wird sein inneres Erleben so dicht, dass Worte versiegen, Gedanken sich ordnen wollen und der Blick sich eher nach innen richtet, um wieder zu erkennen, was gerade geschieht.
Sein Rückzug ist in Wahrheit ein Versuch, die innere Balance wiederherzustellen – und nicht, den anderen zu bestrafen. Sein Schweigen ist oft der Ausdruck einer Überforderung, die nicht in Worte gefasst werden kann, weil das Selbst an jenem Punkt noch keinen Zugang dazu hat, was im Inneren genau gefühlt wird.
Rogers würde sagen, dass der Withdrawer ebenfalls eine Inkongruenz erlebt: das organismische Bedürfnis nach Ruhe und Schutz kollidiert mit einem Selbstbild, das häufig auf Leistungsfähigkeit, Verständnis oder Vernünftigkeit beruhen muss. Dieses „Ich sollte doch…“ steht dann dem „Ich kann gerade nicht…“ gegenüber und erzeugt den Rückzug.
3. Der zirkuläre Prozess – zwei Menschen, die sich schützen und einander dabei verlieren
Wenn diese beiden Bewegungen aufeinandertreffen, entsteht ein kreisförmiger Prozess: Der eine drängt aus Angst, der andere zieht sich aus Überforderung zurück, und jede dieser Bewegungen wirkt – aus dem inneren Bezugsrahmen des anderen – wie eine Bestätigung der schlimmsten Befürchtung.
Der Pursuer spürt den Rückzug und erlebt ihn als Abweisen.Der Withdrawer spürt das Drängen und erlebt es als Übergriff.Und so verstärkt ein schmerzlicher Kreis den anderen.
Rogers würde diesen Prozess nicht als Defekt betrachten, sondern als Ausdruck zweier subjektiver Wirklichkeiten, die sich gegenseitig so sehr beeinflussen, dass beide Partner den Zugang zu ihrem authentischen Selbst verlieren. Der Bezugsrahmen wird eng, das organismische Erleben verliert an Differenziertheit, und beide handeln nicht mehr aus Freiheit, sondern aus Not.
4. Wie ein personzentrierter Zugang diesen Prozess verwandelt
Ein personzentrierter Therapeut versucht nicht, das Muster zu stoppen, indem er Verhalten korrigiert. Vielmehr schafft er einen Raum, in dem die engen inneren Bezugsrahmen sich weiten dürfen. Dies geschieht durch eine Haltung tiefer Empathie, die nicht versucht, zu interpretieren, sondern die Erfahrung des Gegenübers so vollständig und so sensibel zu erfassen, wie es in diesem Moment möglich ist.
Wenn der Pursuer erlebt, dass sein Drängen aus Angst verstanden wird, kann sich in ihm langsam ein Gefühl von Sicherheit einstellen, das ihn befähigt, die darunterliegenden Gefühle zu symbolisieren – und nicht mehr in den Protest zu flüchten.
Wenn der Withdrawer erlebt, dass sein Rückzug nicht als Gleichgültigkeit betrachtet wird, sondern als Versuch, nicht unterzugehen, kann in ihm der Mut wachsen, in der Beziehung sichtbar zu bleiben, auch wenn das innere Erleben noch unklar ist.
Empathie wirkt hier nicht als Technik, sondern als Beziehungshaltung, die beiden Partnern hilft, ihre Inkongruenz zu erkennen und die innere Übereinstimmung wiederzufinden.
5. Die Begegnung – dort, wo beide einander wieder hören können
Sobald beide Partner sich selbst wieder differenziert spüren, entsteht ein neuer Dialog. Die Worte werden langsamer. Die Sätze werden wahrhaftiger. Die Blicke halten einander wieder aus.
Pursuer können beginnen zu sagen: „Ich merke gerade, wie sehr ich fürchte, dich zu verlieren, und wie schwer es mir fällt, ruhig zu bleiben, wenn ich diese Angst spüre.“
Withdrawer können beginnen zu sagen: „Ich merke, dass ich manchmal so überfordert bin, dass ich nicht mehr weiß, wie ich bleiben soll, auch wenn ich das möchte.“
In diesem Moment entsteht etwas, das Rogers den „Prozess der Begegnung“ genannt hätte: ein Raum, in dem zwei Menschen sich nicht als Gegner erleben, sondern als zwei Subjekte, die gemeinsam versuchen, einander zu erreichen.
6. Die Essenz – zwei organismische Bewegungen, die nach Verbindung suchen
In der Tiefe zeigt diese Dynamik uns nicht zwei voneinander getrennte Persönlichkeiten, sondern zwei unterschiedliche Weisen, mit Angst umzugehen. Der eine bewegt sich nach vorne, weil er Nähe braucht, um sich sicher zu fühlen. Der andere bewegt sich nach innen, weil er Ruhe braucht, um sich sicher zu fühlen.
Beide haben recht. Beide handeln aus ihrer Wahrheit heraus.Beide suchen in ihrem Schutzverhalten eigentlich die gleiche Erfahrung: ein Gefühl von angenommen Sein.
Die Aufgabe der Therapie ist es, dieses Angenommen sein erfahrbar zu machen, so dass die Schutzreaktionen sich entspannen und eine Begegnung möglich wird, die nicht von Not, sondern von Freiheit getragen ist.



