Wenn nichts geht – und plötzlich alles hält: Eine Lektion in Resilienz
- Thomas Laggner
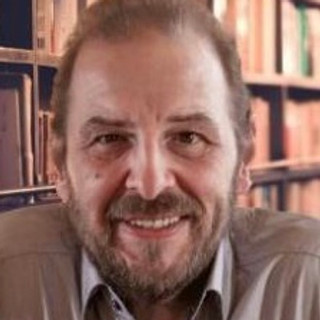
- 25. Okt. 2025
- 3 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 27. Okt. 2025
1. Grundsituation und psychologische Bedeutung
Die Aufgabe, „elf Nägel auf einem Nagelkopf zu balancieren“, konfrontiert die Gruppe mit einem scheinbar unlösbaren Problem.Sie erzeugt Unsicherheit, Widerspruch, Uneindeutigkeit und Erwartungsdruck – jene Faktoren, die im Leben Stress, Überforderung und Krisen auslösen.
Gerade dadurch entsteht ein Lernfeld für Resilienz: Die Gruppe erlebt, wie sie auf Unklarheit, Nichtwissen und Druck reagiert – und wie daraus neue Handlungsfähigkeit wächst.

2. Zentrale Resilienzfaktoren im Gruppenprozess
a) Akzeptanz der Realität
Ein Teilnehmer reflektiert:
„Verhandle ich die Bedingungen? Oder akzeptiere ich das, was gerade ist?“
Solange die Gruppe um Regeln verhandelt, stagniert sie. Erst als sie die Rahmenbedingungen akzeptiert („nur Nägel, kein Klebeband, keine Tricks“), wird freies Denken möglich.Resilienz bedeutet hier, den äußeren Rahmen anzunehmen, statt ihn zu bekämpfen – um die Energie auf das Gestaltbare zu lenken.
b) Selbstwirksamkeit und Eigeninitiative
„Ich muss halt tun. Ich muss angreifen, ich muss mal probieren.“
Resilienz entsteht, wenn Handeln den Platz von Grübeln einnimmt.Die Erfahrung, durch eigenes Tun eine Lösung hervorzubringen, stärkt das Vertrauen in die eigene Wirksamkeit – unabhängig vom Ergebnis.
c) Umgang mit Frustration und Emotion
„Ich war komplett verwirrt, dann frustriert, dann froh, dass es funktioniert.“
Resilienz heißt, emotionale Spannungen zu durchleben, ohne aufzugeben.Die Gruppe lernt, dass Frustration kein Zeichen von Scheitern ist, sondern ein notwendiger Teil des kreativen Prozesses.Diese emotionale Beweglichkeit – das Aushalten, Neubewerten, Weiterprobieren – ist Kernkompetenz seelischer Widerstandskraft.
d) Kognitive Flexibilität
„Es muss technisch gehen – nur anders, als wir denken.“
Der Durchbruch entsteht, als die Gruppe das Problem nicht mehr linear, sondern systemisch betrachtet: Nägel, die sich gegenseitig tragen, statt einzeln auf einem Punkt zu stehen.Das entspricht einem Perspektivwechsel – eine der wichtigsten Resilienzfähigkeiten: Das Verlassen vertrauter Denkmuster, um neue Möglichkeiten zu erkennen.
e) Soziale Verbundenheit
„Ich glaube, ich hätte es ohne die Gruppe nicht geschafft.“„Ich habe mich für dich gefreut – in dem Moment hat’s bei mir Glück gemacht.“
Resilienz ist keine isolierte Eigenschaft. Sie entsteht in Beziehungen, im gemeinsamen Denken, im geteilten Erfolg und im Erleben von Sicherheit.Das Team spürt: Kooperation und emotionale Resonanz stabilisieren, während Konkurrenz und Isolation schwächen.
3. Metakognitive Einsicht
Die Gruppe erkennt selbst:
„Wenn ich die alten Schlüssel nicht mehr anwenden kann, muss ich neue Lösungen finden.“„Ich kann keinen neuen Weg gehen, wenn ich nicht akzeptiere, was jetzt da ist.“
Diese Aussagen zeigen eine reife, selbstreflexive Resilienzkompetenz.Das Bewusstsein, dass Resilienz bedeutet, aus der aktuellen Lage – nicht aus Wunschdenken – zu handeln, wird explizit formuliert.
4. Emotionale Entwicklung
Der Gruppenprozess verläuft in klar erkennbaren emotionalen Phasen:
Orientierung: Unsicherheit, Fragen, Suche nach Regeln
Widerstand: Ungeduld, Verhandlungen, Zweifel
Exploration: Probieren, Risiko, erste Ideen
Lösung: Erleichterung, Freude, Stolz
Reflexion: Sinnfindung, Metawissen
Die Gruppe erlebt eine emotionale Welle, die von Desorientierung zu Selbstvertrauen führt – ein exemplarischer Verlauf von Krisenbewältigung.
5. Soziale Dynamik und Resilienz im Miteinander
Unterschiedliche Rollen entstehen:
Der Analytiker (fragt nach Regeln)
Der Macher (probiert aus)
Die Beobachterin (reflektiert Prozesse)
Die Moderatorin (achtet auf Kommunikation)
Diese Vielfalt ermöglicht Lernen auf mehreren Ebenen.Resilienz zeigt sich hier als Systemqualität: Nicht eine Person „ist resilient“, sondern das ganze soziale Feld trägt die Lösung.
„Wir sind das Problem. Wir sind die Lösung.“
Diese Aussage fasst den systemischen Kern von Resilienz zusammen.
6. Existentielle und symbolische Dimension
Der physikalische Trick – Nägel, die sich gegenseitig tragen – wird zum Symbol:
Stabilität entsteht nicht durch Starrheit, sondern durch Beziehung.
Gleichgewicht entsteht, wenn Gegensätze sich ausbalancieren.
Das Ganze ist stabil, weil jeder Teil flexibel ist.
Übertragen:Resilienz bedeutet nicht Härte, sondern Elastizität im System der eigenen Kräfte, Gedanken und Beziehungen.
7. Zusammenfassung der Lernaspekte
Resilienzfaktor | Erfahrung in der Übung | Erkenntnis |
Akzeptanz | Unklare Regeln annehmen | Realität statt Wunschdenken |
Selbstwirksamkeit | Handeln statt Warten | Ich kann gestalten |
Emotionale Regulation | Frust durchleben | Gefühle halten lernen |
Kognitive Flexibilität | Perspektivenwechsel | Neues Denken ermöglicht Lösungen |
Beziehung | Miteinander statt Allein | Wir tragen einander |
Optimismus | „Wenn er uns die Aufgabe stellt, wird’s gehen“ | Vertrauen ins Gelingen |
Sinn | „Man weiß nie, ob man beim Rohr oder beim Diamanten ist“ | Sinn entsteht im Nachhinein |
8. Fazit
Aus der Nagelübung lässt sich ableiten:
Resilienz ist kein fester Zustand, sondern ein Prozess, der sich im Handeln, Fühlen und Denken vollzieht.Sie wächst, wenn Menschen– den Rahmen annehmen,– aktiv werden,– Frustration aushalten,– sich mit anderen verbinden und– das Neue im Ungewissen entdecken.
Oder als Kernformulierung:Resilienz heißt, in einer unlösbar scheinenden Situation so lange zu balancieren, bis die Spannung selbst zum Halt wird.



