Von der Supervision zur Praxis
- Thomas Laggner
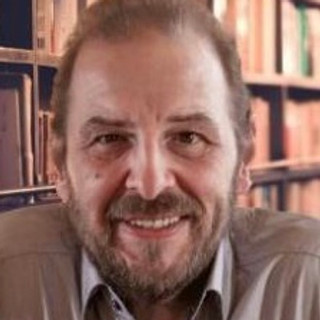
- 26. Okt. 2025
- 4 Min. Lesezeit
Einleitung: Wie aus einer Bitte um Supervision ein Lernstück für alle wurde
Am Anfang stand eine einfache, mutige Bitte: Eine Teilnehmerin unserer Ausbildungsgruppe ersuchte die anderen explizit um Supervision – nicht als formalen Pflichttermin, sondern als kollegiale Ressource. Ihr Anliegen: Ein Team im psychosozialen Setting war in eine Schieflage geraten – Neue fühlten sich nicht zugehörig, Dienstpläne wirkten unfair, informelle Koalitionen bestimmten den Ton, und die Leitung rang um Autorität. Statt darüber zu klagen, bat sie uns: „Schaut mit mir gemeinsam drauf – was übersehe ich, was braucht das System?“
Was dann geschah, war mehr als „noch eine Supervision“. Wir entschieden uns bewusst für eine klare Rahmung: Zuerst ein Lagebild aus vier Perspektiven (Leitung, Neue, Team, Organisation), dann die Diagnose entlang der drei Systemprinzipien (Zugehörigkeit, Reihenfolge, Leistung/Ausgleich). Aus dieser Struktur entstanden konkrete Interventionen – kein Appell an „mehr Wertschätzung“, sondern operative Bausteine: ein Kommunikationskodex(Ich-Botschaften, 2-Minuten-Timer, Stopp-Regel, Reflecting-Team), ein Fairness-Index mit Ampel für den Dienstplan, Onboarding mit Check-ins in Woche 1/4/7, Mentoring als Pflicht der Erfahrenen, RACI für Rollen/Entscheidungen und ein Konsequenzkorridor mit fünf klaren Stufen.
Das Ergebnis: spürbare Entspannung der Kommunikation, sichtbarer Schutz für Neue, eine fairere Dienstplanung(objektiviert statt gefühlt), Verantwortungsklarheit durch RACI – und vor allem Commitment: Am Ende benannte jede Person ihren konkreten Beitrag bis zum Review. Aus einer individuellen Bitte wurde ein Team-Lernprozess, der nicht nur dieses Setting stabilisierte, sondern uns allen zeigte, wie Form Fürsorge ist: Wenn Regeln, Rollen, Messgrößen und Konsequenzen stehen, wird Supervision zur Sinnstifterin statt zum Verstärker alter Muster.
Diese Einleitung markiert den Startpunkt unseres Blog-Beitrags: Wir zeichnen nach, wie wir vorgegangen sind, was wir entschieden haben und warum genau diese Schritte wirken – damit ihr die Werkzeuge (Kodex, Fairness-Index, Onboarding-Timeline, RACI, Konsequenztreppe) sofort in eurer eigenen Beratungspraxis nutzen könnt.

Was wir aus dem Team-Charta-Prozess lernen können (Reflexionsbericht für die Lebensberater-Ausbildungsgruppe)
Kurzfassung: Ein dysfunktionales Team wurde nicht durch „mehr Wertschätzung“, sondern durch klare Formate, Regeln, Rollen, Messgrößen und Konsequenzen stabilisiert. Für unsere Praxis heißt das: Form schlägt Stimmung, Erfahrung verpflichtet, Messbarkeit entgiftet Debatten – und Konsequenzen sind Fürsorge.
1) Ausgangslage & Auftrag – ein System in der Krise
Neue Kolleg:innen fühlten sich nicht zugehörig, Dienstpläne wirkten willkürlich, informelle Koalitionen dominierten, die Leitung hatte Autorität eingebüßt. Der Auftrag: Klare Regeln und Strukturen, die für alle gelten.Das Lagebild in vier Perspektiven (Leitung, Neue, Team, Organisation) verhinderte vorschnelle Parteinahme und sammelte alle relevanten Wahrheiten, bevor entschieden wurde.
2) Drei Systemprinzipien – „Hellinger meets Governance“
Die Diagnose wurde konsequent an drei Prinzipien ausgerichtet und operativ übersetzt:
Zugehörigkeit: Gesicherter Platz ab Tag 1.Praxis: Strukturiertes Onboarding mit 2 Mentor:innen, Check-ins in Woche 1/4/7, „Stimme der Neuen“ eröffnet Reviews.
Reihenfolge: Erfahrung wird gewürdigt – und verpflichtet zu Mentoring.Praxis: Senior:innen planen Lernschichten, berichten regelmäßig über Mentoring-Fortschritte.
Leistung/Ausgleich: Beiträge werden sichtbar und fair verteilt.Praxis: Fairness-Index (±10 % Toleranz) mit Ampel (GRÜN/GELB/ROT) und transparenten Kriterien.
Kernnutzen: Die Prinzipien bleiben nicht moralisch, sondern werden als Prozesse mit Terminen und Indikatorengeführt.
3) Kommunikationskodex – Struktur schafft Sicherheit
Statt vager Appelle: Ich-Botschaften, 2-Minuten-Timer, Stopp-Regel, Reflecting Team.Warum das wirkt: In erhitzten Systemen sind Geländer hilfreicher als Freiräume; der Kodex senkt Erregung, schützt Minderheiten (Neuzugänge) und macht Moderation handhabbar.
Übertrag in Einzel-/Paarberatung: Für strittige Themen Redezeit-Rituale einführen; nach jedem Slot Spiegeln statt Debattieren.
4) Fairness objektivieren – der Index mit Ampel
Der Fairness-Index übersetzt „gefühlte Ungerechtigkeit“ in überprüfbare Kriterien:
Unbeliebte Dienste pro Person: Spannweite ≤ ±10 %
Anteil Wochendienste: Spannweite ≤ ±10 %
Fixtermine berücksichtigt: JA/NEIN-Quote
Ampel: GRÜN = Freigabe, GELB = Anpassung, ROT = Neuplanung mit Leitung
Double-Check der ersten 5 Pläne durch die Leitung
Übertrag in Beratung: Haushalts-/Care-Work, Kontaktzeiten, „Mental Load“ per Wochenübersicht messbar machen → weg von Schuld/Scham, hin zu Planung/Nachsteuerung.
5) Rollen klären – RACI verhindert Grauzonen
RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) wurde für Dienstplan, Onboarding/Mentoring, Urlaub, Konfliktklärung festgelegt.Wirkprinzip: RACI entzieht informeller Macht den Nährboden, entlastet Leitung und macht Erwartungen justiziabel.
Übertrag: In Familien/Patchwork klärt RACI z. B. Hausaufgaben, Absprachen, Entscheidungswege.
6) Verankerung – KPIs, Reviews, kurzer Regelkreis
Statt Hoffen: Monatsreview und Quartalsblick mitOnboarding-Fortschritt, Fairness-Index, Fluktuation/Krankenstand, Entwertungs-Incidents, Supervisions-Zielerreichung.Transparenz baut Misstrauen ab und hält Musterveränderung auf Kurs.
7) Konsequenzkorridor – ohne Drohen, aber mit Folgen
Fünf Stufen:
Hinweis (protokolliert) → 2) Auflage (konkret + Termin) → 3) Funktionsentzug → 4) Rollenwechsel/Versetzung → 5) Personalrecht.Haltung: Konsequenzen sind fürsorglich, weil sie das Ganze schützen.
8) Praxisfälle – vom Wissen ins Handeln
Fall 1: Unfaire DienstplanverteilungROT im Index → Neuplanung nach Kriterien, Transparenz, Coaching für Planungsverantwortliche, Double-Check weiterer Pläne.
Fall 2: Ausgrenzung einer NeuenKodex-Verstoß → Stopp-Regel, Moderation + Reflecting Team, Mentor:innen sichern Schutz, Auflage mit Termin.
Transferfrage für Klient:innen: „Wenn X wieder passiert, wer macht was binnen 10 Minuten? Woran messen wir in 4 Wochen, dass es besser ist?“
9) Abschlussrunde – Commitment sichtbar machen
Zum Ende nennt jede Person einen konkreten Beitrag bis zum Review („Mein nächster Schritt“, „Welche Unterstützung brauche ich?“). So wird Verantwortung personalisiert statt im Team zu verdunsten.
10) Was ich für meine Praxis mitnehme (destilliert)
Mehrere Wahrheiten gleichzeitig – erst sammeln, dann strukturieren (4-Perspektiven-Lagebild).
Struktur = Fürsorge – Rituale, Kodex, Timer, Stopp-Wort, Check-ins.
Objektivierung – Fairness-Index/Ampel statt Endlosdiskussion.
Rollenlogik – RACI in Familien, Paaren, Teams einsetzen.
Konsequenzpläne – transparent, fristgebunden, eskalierbar.
11) Mini-Toolkit (sofort einsetzbar)
Auftragskärtchen pro Sitzung: Format? Ziele (max. 3)? Entscheidung heute? Wer macht was bis wann? Ampel in 4 Wochen?
Kommunikationsritual: 2-Min-Slots → Spiegeln → Zusammenfassen → Entscheidung.
Fairness-Quick-Audit: Eine Woche sichtbare + unsichtbare Arbeit erfassen; GRÜN/GELB/ROT; Maßnahmen ableiten.
RACI-Skizze: Wer ist R/A/C/I für 3 wiederkehrende Konfliktthemen?
Konsequenztreppe: 3 Stufen vordefinieren, vorher vereinbaren, nachher vollziehen.
12) Haltung, die trägt
„Ich bin Teil der Geschichte dieses Systems – und ich darf sie mitgestalten.“Gestalten heißt: Rahmen setzen, Regeln halten, Menschen sehen. Dann wird Supervision das, was sie sein soll: Sinnstifterin statt Konfliktverstärkerin.
Materialien (optional beilegen)
Folienset „Team-Charta 2026 & Maßnahmen“ (Agenda, Systemprinzipien, Kodex, Fairness-Index & Ampel, Onboarding-Timeline, RACI, KPIs/Reviews, Eskalationspfad, Praxisfälle, Abschlussrunde).



