🎭 Zwischen Ich und Du
- Thomas Laggner
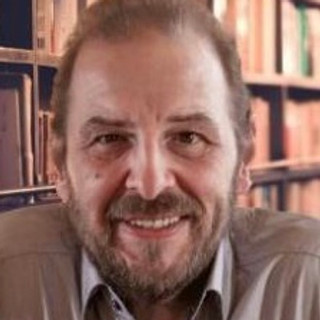
- 8. Okt. 2025
- 3 Min. Lesezeit
Die Stuhlübung zur Arbeit mit projektiven Anteilen in familiären Beziehungen
Wenn emotionale Verstrickungen uns nicht loslassen, obwohl wir sie rational längst verstanden haben, ist meist mehr im Spiel als ein ungelöstes Gespräch.

Gerade in familiären Beziehungen – etwa zwischen Geschwistern – wirken tief verwurzelte Dynamiken, die über bewusste Konflikte hinausgehen. Eine erprobte Möglichkeit, solche unbewussten Bindungsmuster sichtbar und bearbeitbar zu machen, ist die Stuhlübung mit projektiven Anteilen.
In diesem Beitrag zeige ich, wie diese Methode funktioniert, worauf man achten sollte – und warum sie therapeutisch so wirksam ist.
🧩 Warum projektive Anteile so hartnäckig sind
In therapeutischen Prozessen berichten Klient:innen häufig davon, sich emotional stark von bestimmten Personen beeinflusst oder verletzt zu fühlen, obwohl „eigentlich alles gesagt“ ist. Beispiel:
„Ich weiß, es ist sein Leben – aber ich bin trotzdem ständig betroffen.“
Solche Sätze deuten auf eine tiefere innere Verstrickung hin, in der eigene ungeliebte Anteile – etwa Ohnmacht, Chaos, Bedürftigkeit oder Aggression – unbewusst auf andere projiziert werden. In unserem Fall etwa auf den Bruder.
Projektion bedeutet hier:Was ich in mir selbst nicht sehen oder fühlen will, „finde“ ich im anderen wieder – meist mit großer emotionaler Aufladung.
🛠️ Die Stuhlübung – ein strukturiertes Begegnungsritual
Die Stuhlübung ist eine dialogische Methode, die projektive Prozesse externalisiert, symbolisiert und damit bearbeitbar macht. Der Klient tritt in ein symbolisches Gespräch mit der Projektionsfigur – z. B. dem Bruder – und gewinnt dadurch emotionale Differenzierung und Selbstverstehen.
Die Methode entstammt ursprünglich der Gestalttherapie (Fritz Perls) und wird heute in vielen therapeutischen Schulen kreativ weiterentwickelt.
🪑 Ablauf der Übung – Schritt für Schritt
1. Vorbereitung: Inneres Bild aktivieren
Therapeut:in:🗨️ „Stell dir deinen Bruder bitte so vor, als säße er dir jetzt gegenüber. Lass dir Zeit. Wie geht es dir, wenn du ihn siehst?“
Ziel: emotionale Aktivierung, Zugang zu Affekt und Körperempfindung
2. Erste Position: Ich spreche zu Dir
Der Klient bleibt auf seinem Stuhl und spricht in der Du-Form:
„Ich ärgere mich so über dich, weil du dich nie um etwas kümmerst...“„Ich wünschte, du würdest mir endlich zeigen, dass ich dir wichtig bin.“
👉 Erlaubt sind alle Emotionen: Wut, Enttäuschung, Sehnsucht, Schuld, Rückzug. Der Therapeut hält den Raum – ohne Bewertung.
3. Rollenwechsel: Ich bin Du
Der Klient wechselt auf den gegenüberliegenden Stuhl und übernimmt nun – so gut es geht – die Perspektive des Bruders:
„Ich weiß, dass ich dich oft enttäuscht habe. Aber ich hatte nie die Kraft...“„Ich verstehe gar nicht, was du von mir willst.“
Ziel: Zugang zu verborgenen Perspektiven, Übernahme des „fremden“ Anteils, symbolisches Selbstgespräch
👉 Wichtig: Es geht nicht um Richtig oder Falsch, sondern um emotionale Tiefenschichten.
4. Dritte Perspektive: Der Beobachter
Der Klient nimmt nun eine neutrale Position ein, z. B. einen dritten Stuhl oder eine imaginierte Beobachterrolle.
Fragen der Therapeut:in:
„Was siehst du, wenn du euch beide beobachtest?“
„Was fällt dir an eurer Dynamik auf?“
„Wer trägt was – wer schützt wen – was wird nicht gesagt?“
Ziel: symbolisierende Verarbeitung, Mustererkennung, Selbst-Mitgefühl
5. Integration: Was gehört zu mir, was zu dir?
Der Therapeut lädt nun zur Rückbindung ein:
🗨️ „Was hast du über dich selbst erfahren, während du mit deinem Bruder gesprochen hast?“🗨️ „Gibt es etwas, das du in ihm gesehen hast, was vielleicht auch ein Teil von dir ist?“🗨️ „Was darf bei dir bleiben – und was darfst du getrost bei ihm lassen?“
🧠 Therapeutische Wirkung
Diese Übung wirkt auf mehreren Ebenen:
Ebene | Wirkung |
Affektiv | Emotionale Entladung, Würdigung unterdrückter Gefühle |
Kognitiv | Neue Sichtweisen, Mustererkenntnisse |
Symbolisch | Externe Repräsentation innerer Konflikte |
Integrativ | Rückführung abgespaltener Anteile in das Selbst |
Viele Klient:innen erleben durch diese Übung erstmals eine Entlastung von der emotionalen Dauerbesetzung durch andere.
🧭 Hinweise für die therapeutische Begleitung
Timing ist alles: Die Übung sollte nur durchgeführt werden, wenn bereits ein stabiles Arbeitsbündnis besteht.
Affekte halten: Die Klient:in darf wütend, traurig, verwirrt oder sprachlos sein. Wichtig ist, dass sie dabei nicht allein gelassen wird.
Nicht deuten, sondern begleiten: Die Therapeut:in sollte möglichst wenig „übersetzen“, sondern Raum geben für Selbsterleben.
Nachsorge: Ein kurzes Grounding am Ende (z. B. Körperwahrnehmung, Atem, Selbstfürsorge-Frage) hilft, das Erlebte zu integrieren.
🎓 Für Supervision & Lehre: Reflexionsfragen
Welche inneren Anteile wurden sichtbar?
Gab es Widerstände im Rollenwechsel – warum?
Welche Beziehungsmuster wurden deutlich (z. B. Symbiose, Parentifizierung, Loyalitätskonflikte)?
Wie ging die Therapeut:in mit emotionaler Intensität um?
Welche Übertragungsdynamiken könnten sich in der Sitzung zeigen?
🧶 Fazit
Die Stuhlübung ist weit mehr als eine psychodramatische Technik. Sie ist ein spürbarer Ausdruck innerer Beziehungsmuster – und ein machtvoller Schritt in Richtung emotionaler Eigenverantwortung.
Gerade im Kontext von familiären Bindungen – wie etwa der Beziehung zu einem Bruder – kann sie helfen, alte Rollenbilder zu lösen, projizierte Anteile zu erkennen und den Weg zu einem selbstbestimmteren Umgang zu ebnen.
„Ich darf mich lösen – ohne zu entwerten.“„Ich darf sehen – ohne alles verstehen zu müssen.“„Ich darf fühlen – ohne verloren zu gehen.“



