Wenn das Verstehen scheitert – Zwischen Nähe, Missverständnissen und innerer Leere
- Thomas Laggner
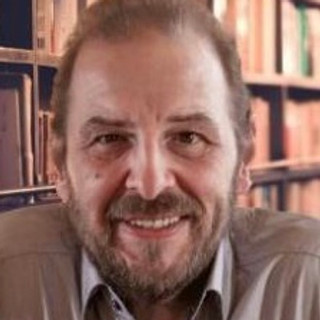
- 31. März 2025
- 2 Min. Lesezeit
Fallgeschichte (Kurzfassung für Ausbildungsgruppe)
Klientin, 31 Jahre, angestellt, lebt in stabilen äußeren Verhältnissen (Arbeit, Freunde, Familie), leidet jedoch seit mehreren Wochen unter grundloser Traurigkeit, Antriebslosigkeit, innerer Leere und sozialer Erschöpfung.
Besonders belastend empfindet sie wiederholte kommunikative Missverständnisse in ihrem Freundeskreis, bei denen sie sich unverstanden und abgelehnt fühlt. Sie beschreibt ein starkes Bedürfnis nach Klärung und Verstehen, reflektiert viel, kann aber keine konkrete Ursache identifizieren. In der Therapie zeigt sie sich sehr offen, selbstreflektiert und motiviert zur Veränderung. Themen wie Zugehörigkeit, Selbstwert und Kommunikationsmuster stehen im Zentrum.

„Ich will es einfach nur gut machen.“Ein Satz, der hängen bleibt. Eine Klientin, 31 Jahre alt, sitzt in der Praxis. Sie arbeitet, sie plant Urlaub, sie hat Freunde. Und doch: Sie fühlt sich grundlos traurig, innerlich leer und zunehmend missverstanden.
Was sie erzählt, trifft viele:„Ich stelle eine Frage – und plötzlich herrscht dicke Luft.“„Ich erkläre mich – und werde unterbrochen.“„Ich versuche, niemanden zu verletzen – und stehe am Ende als die Schuldige da.“
In ihrer Stimme liegt keine Wut, sondern Erschöpfung. Eine stille Verzweiflung, die sich nicht durch laute Vorwürfe entlädt, sondern in einem verzweifelten „Warum?“ feststeckt. Warum reicht es nicht, einfach Interesse zu zeigen? Warum wird Hinterfragen als Angriff erlebt?
Das Paradox: Funktional im Außen, verzweifelt im Innen.Die Klientin ist reflektiert, klug, sensibel – und dennoch in einer Dauerschleife aus Selbstzweifeln gefangen. Sie stellt sich in Frage, weil andere sie nicht verstehen (wollen?). Ihre Geschichte zeigt, wie schmerzhaft es sein kann, sich mitzuteilen – wenn das Gegenüber nicht hören will.
Und doch: Es gibt Hoffnung.In der Therapie entwickelt sie die Idee eines „sozialen Puffers“ – ein gedanklicher Schutzraum, bevor die emotionale Wucht einer Missdeutung sie trifft. Sie beginnt, Gruppen zu beobachten, zu analysieren. Nicht mehr nur Betroffene sein, sondern Beobachterin. Forscherin ihrer eigenen sozialen Welt.
Ein kraftvoller Schritt.Denn manchmal beginnt Veränderung dort, wo man aufhört, sich selbst als Problem zu sehen – und beginnt, sich selbst als Schatztruhe zu betrachten, die andere einfach nicht zu öffnen wissen.
📋 ICD-10-Diagnosehypothese
Basierend auf dem Gespräch lassen sich folgende ICD-10-Diagnosen hypothetisch in Betracht ziehen:
F32.1 – Mittelgradige depressive Episode
Andauernde Traurigkeit ohne konkreten Auslöser („Ich bin grundtraurig, ohne Grund“)
Interessenverlust und Freudlosigkeit („Ich mache mir Belohnungs-To-Dos, aber ich tue es nicht“)
Energieverlust und Erschöpfung („Ich funktioniere nur durch meine Routine“)
Selbstzweifel („Ich suche den Fehler bei mir“)
Schlafstörungen („Ich schlafe, aber ich bin nicht ausgeruht“)
Z73.0 – Burn-out / Zustand der totalen Erschöpfung
Hohe Diskrepanz zwischen äußerer Funktionsfähigkeit und innerer Erschöpfung
Gefühl der emotionalen Leere trotz intaktem Umfeld
Z63.5 – Schwierige Beziehung zu Freunden
Wiederholte interpersonelle Konflikte ohne Möglichkeit zur Klärung
Subjektives Empfinden von Ablehnung und Missverstehen in der Peer-Gruppe
🔍 Abgrenzung zur psychosozialen Beratung (z. B. Lebens- und Sozialberatung)
Ein psychosozialer Berater könnte unterstützend tätig werden, besonders bei der sozialen Rollenklärung, der Kommunikationsanalyse und Alltagsstrukturierung. Allerdings ist die Tiefe der affektiven Symptomatik und die Nähe zu einer depressiven Störung ein klarer Hinweis auf die Notwendigkeit psychotherapeutischer Begleitung. Ein Berater könnte flankierend arbeiten, z. B. zur Ressourcenerweiterung, aber nicht als primärer Behandler.



