Wenn Kindheit keine Kindheit war – über Erschöpfung, Trauma und Befreiung
- Thomas Laggner
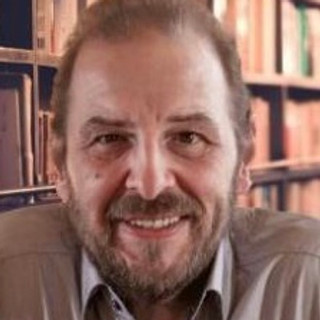
- 15. Apr. 2025
- 3 Min. Lesezeit

„Ich war zehn und die ganze Woche allein in der Wohnung. Damals war’s normal – heute merke ich, wie sehr mich das geprägt hat.“
🌪️ Zwischen Albträumen und Dauererschöpfung
Eine junge Frau in ihren Zwanzigern sucht psychotherapeutische Hilfe. Seit Monaten fühlt sie sich chronisch müde, findet keine Erholung – weder durch Schlaf noch durch Freizeit. Albträume und psychosomatische Beschwerden (Magenprobleme, Übelkeit) begleiten sie. Trotz äußerlich stabiler Lebensverhältnisse (Partnerschaft, Job im Homeoffice) empfindet sie das Leben als „ständiges Sich-Zusammenreißen“.
👁️ Eine Kindheit im Schatten
Nach und nach öffnet sie sich: Die Eltern trennten sich, als sie sechs war. Der Vater verschwand aus ihrem Leben, die Mutter wurde kontrollierend und gleichzeitig emotional abwesend. Ab dem zehnten Lebensjahr verbrachte sie unter der Woche allein in einer Wohnung – ohne Begleitung, ohne emotionale Sicherheit.
Ihre Mutter kontrollierte später sogar ihr Konto, rief sie zehnmal täglich an, war gleichzeitig nie wirklich da. Ein toxisches Wechselspiel aus Übergriff und emotionalem Rückzug. Jahre später gelingt der Befreiungsschlag: Ein Wohnungsbrand wird zum Auslöser, mit 18 zieht sie endgültig aus. Doch die seelischen Spuren bleiben.
🧠 Wenn das Nervensystem nicht vergisst
Im Gespräch entfaltet sich das Zusammenspiel von früher Vernachlässigung, Dauerstress und körperlicher Symptomatik. Der Therapeut erklärt Zusammenhänge zwischen Kindheitstrauma, Überlebensreaktionen (Erstarren, Erschöpfung) und Nervensystem – alltagsnah und verständlich.
💬 Relevante Mikroprozesse für die Ausbildung
Validierung: „Im Grunde bist du vernachlässigt worden.“ – eine mutige, klare Spiegelung.
Reframing: Der Wohnungsbrand wird als Startpunkt zur Autonomie sichtbar gemacht.
Psychoedukation: Der Zitronenvergleich macht biologische Stressreaktionen greifbar.
Ressourcenaktivierung: Die Klientin wird für ihren Weg zur Selbstständigkeit bestärkt.
🎯 Zentrale Dialogstellen für Ausbildungszwecke
🧩 1. Erste Thematisierung des Kindheitstraumas
„Ja, also ich habe nicht so eine leichte Kindheit sozusagen gehabt. Und ich habe das eigentlich immer so mitgenommen.“
Lehrfokus:
Einstieg in Trauma-Themen.
Subjektive Formulierungen („nicht so leicht“) als Indikator für emotionale Schutzmechanismen.
Bedeutung des Raums, der hier durch die offene Frage gegeben wird.
🧩 2. Körperliche Symptomatik und psychosomatische Verbindung
„Und durch das ganze Erbrechen immer und alles ist mein Magen jetzt immer offen.“
Lehrfokus:
Verbindung zwischen psychischem Stress und somatischer Reaktion.
Möglichkeit, Psychoedukation und Normalisierung einzubetten.
Umgang mit medizinischen Themen im psychotherapeutischen Setting.
🧩 3. Lebenslange Belastung durch dysfunktionale Mutterbeziehung
„Ich weiß nicht, ob das mich noch runterzieht, weil ich immer geweint habe danach, und tagelang Gedanken darüber gemacht habe.“
Lehrfokus:
Zirkuläre Dynamiken von Beziehung, Emotion und psychosomatischer Reaktion.
Tiefe innere Ambivalenz sichtbar.
Gute Gelegenheit, um Interventionen zu explorieren: z. B. Externalisierung, Arbeit mit inneren Anteilen.
🧩 4. Therapeutische Benennung von Vernachlässigung
Therapeut: „Im Grunde bist du vernachlässigt worden.“
Lehrfokus:
Mut zur Konfrontation mit klarer Sprache.
Validierung und Spiegelung im therapeutischen Prozess.
Ethik: Umgang mit Hypothesen und diagnostischen Rückmeldungen.
🧩 5. Ressourcenaktivierung und Reframing
„Ja, gratuliere. Voll hineingestoßen.“
Lehrfokus:
Verstärkung von Selbstwirksamkeit.
Reframing von traumatischem Ereignis (Wohnungsbrand) als Wendepunkt.
Förderung von Ich-Stärkung.
🧩 6. Körperorientierte Psychoedukation: Nervensystem und Zitrone
„Also für dieses Nervensystem ist alles real.“
Lehrfokus:
Vermittlung komplexer Zusammenhänge mit alltagsnahen Beispielen.
Körper-Psyche-Zusammenhang (Polyvagaltheorie).
Humor als beziehungsförderndes Element.
🩺 Relevante ICD-10-Diagnosen
🔹 F43.1 – Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) (möglicherweise subklinisch oder partiell)
Begründung:
Wiederkehrende Albträume, chronische Erschöpfung, erhöhte Wachsamkeit.
Traumatisierende Kindheitserfahrungen: emotionale Vernachlässigung, Verlassenheit (Wochen allein gelassen mit 10 Jahren).
Körperliche Symptome als Folge früherer Belastung.
Vermeidung und Abspaltung („Ich verdränge“, „Ich will nicht drüber reden“).
🔹 F32.1 – Mittelgradige depressive Episode
Begründung:
Deutlich eingeschränkter Antrieb, Schlafverlangen bis in den Nachmittag, keine Regeneration, Interessenverlust.
Dysphorische Stimmung, Energielosigkeit.
Funktionserhalt durch äußeren Druck („ich zwinge mich“), jedoch keine Freude oder Erleichterung.
🔹 F45.0 – Somatisierungsstörung (Teilaspekt)
Begründung:
Chronische Magenproblematik ohne organisch erklärbare Ursache (offener Magen, Helicobacter, Reizmagen).
Enge Verbindung zwischen psychischem Stress und körperlichen Symptomen.
🔹 F19.21 – Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch in Remission
Begründung:
Frühere Drogenverwendung als Bewältigungsversuch in belastender Lebensphase.
Seit zwei Jahren clean, jedoch Rückwirkungen auf Gesundheit und emotionale Regulation.
🟡 Relevante Z-Diagnosen
🔸 Z63.0 – Probleme in Beziehung zu den Eltern
Klare narrative Belege für dysfunktionale, destruktive Mutterbindung.
Trennung vom Vater im Kindesalter, keine Beziehung mehr seit dem 10. Lebensjahr.
🔸 Z60.0 – Probleme mit sozialem Umfeld
Kontaktabbrüche zu Geschwistern.
Fehlende familiäre Unterstützung.
🔄 Abgrenzung zur Lebens- und Sozialberatung
Ein Lebens- und Sozialberater könnte in diesem Fall:
Stabilisierende Maßnahmen anbieten (Alltagsstruktur, Ressourcenstärkung).
Soziale Unterstützung aktivieren (z. B. Freizeitgestaltung, Entlastungsgespräche).
Praktische Beratung zu Ernährung, Tagesstruktur und Gesundheitsvorsorge leisten.
Nicht erlaubt oder indiziert wären:
Traumatherapeutische Interventionen.
Tiefenpsychologische oder systemische Bearbeitung von Eltern-Kind-Dynamiken.
Diagnostik und Differenzialdiagnostik.
👉 Der Fall gehört deutlich in das psychotherapeutische Feld.
🔍 Lehrfazit
Dieser Fall zeigt exemplarisch, wie frühe Traumatisierungen subtil nachwirken – und wie wichtig es ist, achtsam, validierend und körpernah zu arbeiten. Ein sensibler Blick auf Mikroprozesse eröffnet den Weg zur Heilung.



